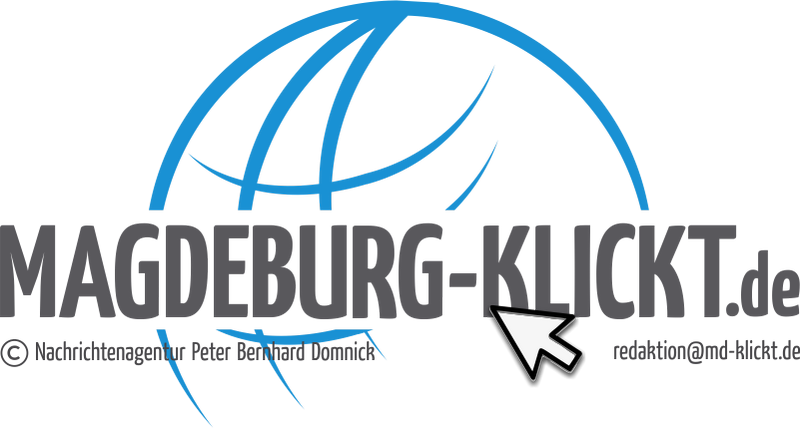Der stellvertretende FDP-Bundesvorsitzende Wolfgang Kubicki (Foto) schrieb für Cicero Online folgende Kolumne:
Ich habe eine gute, eine ernüchternde und eine schlechte Nachricht für meine Leserinnen und Leser. Zuerst die gute: Hamburg wird 2040 nicht im Meer untergehen. Die ernüchternde Nachricht ist: Dass Hamburg in nächster Zeit nicht untergehen wird, steht in keinem kausalen Zusammenhang mit dem von Fridays for Future angestrebten und gewonnenen Klimaentscheid, wonach die Hansestadt bereits 2040 klimaneutral sein soll. Die schlechte Nachricht ist, dass der Entscheid durchaus Wirkung entfalten wird – und zwar eine katastrophale. Zumindest, wenn man das Ergebnis ernst nimmt, und ich würde jetzt einfach mal empfehlen, dass man das macht.
Der Klimaentscheid heißt in Wahrheit gar nicht Klimaentscheid, sondern Zukunftsentscheid. Und das ist auch der richtige Name. Hamburg hat sich gegen die eigene Zukunft entschieden. Aber bevor wir uns mit der Frage beschäftigen, warum Hamburg das getan hat, schauen wir uns die realen Auswirkungen der Entscheidung an:
Einer der größten Faktoren beim CO₂-Ausstoß ist der Gebäudesektor. Wohnen wird in Hamburg also teurer werden. Und es wird schneller teurer werden als vor dem Zukunftsentscheid. Da helfen auch plakative Beteuerungen, den Entscheid „sozial gerecht“ umsetzen zu wollen, nichts. Andreas Breitner, Vorsitzender vom Verband Norddeutscher Wohnungsunternehmen und aufrechter Sozialdemokrat vom alten Schlag, hat hierauf hingewiesen und auch darauf, dass man nicht jede Belastung „wegfördern“ kann.
Aber nicht nur die Hamburgerinnen und Hamburger wird es treffen, auch diejenigen, die in die Stadt pendeln müssen. Denn Hamburg wird den Verkehr drastisch reduzieren müssen. Flächendeckend Tempo 30 wird da nur ein Zwischenschritt sein können. Und wer jetzt selbstsicher auf die Alternative auf der Schiene verweist, sollte sich vielleicht mal mit den Zuständen am Hamburger Hauptbahnhof beschäftigen – diesem ohnehin schon völlig überfüllten Nadelöhr, das täglich den Fahrplan im norddeutschen Raum durcheinanderwirbelt. Die einzige Chance ist, dass sich das Problem des Pendelns dadurch erledigen wird, dass es bald schlicht keinen Grund mehr geben wird, in die Stadt zu pendeln. Zwischen acht und neun Millionen Container werden im viertgrößten Hafen Europas etwa jährlich verladen. Klimaneutral wird das nicht funktionieren, weil Segelschiffe sich für den Güterverkehr auf See einfach nicht so recht durchsetzen konnten. Und die acht bis neun Millionen Container wollen ja auch zum und vom Hafen transportiert werden. Mit Elektro-Lastkraftwagen wird das vorerst nicht möglich sein. Also machen wir den Hamburger Hafen am besten einfach zu, sparen dadurch die Arbeitsplätze und lösen die Frage der Pendelei: Wo keine Arbeit, da auch kein Berufsverkehr. Das Beste wäre wohl überhaupt, den Bundesverkehrswegeplan so anzupassen, dass Hamburg gar nicht mehr richtig an die Straße angebunden ist. Für meine schleswig-holsteinische Heimat bedeutet das eine Chance, denn vielleicht würden selbst die erbittertsten und verbohrtesten Autobahngegner sich überzeugen lassen, den Ausbau der A20 zu beschleunigen – wenn wir sie nur weit genug an Hamburg vorbeiführen.
Sie merken den vorangegangenen Zeilen vielleicht an, dass ich gewisse Dinge nur noch mit Spott ertragen kann. Denn in Wahrheit liebe ich Hamburg natürlich. Und deswegen bestürzt mich der Sieg der Klima-Populisten zusätzlich. Diese schöne und stolze Stadt hat es nicht verdient, dass der Verstand von irrationaler Angst so zunieder gemacht wird. Aber so ist es nun einmal, und damit gilt es umzugehen. Wenn man erklären will, wie es so weit kommen konnte, muss man sich mit der aktuellen Klimadebatte auseinandersetzen und damit, wie wir sie in Deutschland inzwischen führen.
Denn zunächst gilt es, eines unmissverständlich festzuhalten: Der Hamburger Entscheid hat exakt 0,0 Einfluss auf die Veränderungen der klimatischen Bedingungen auf unserem Planeten. Dazu gibt es keine zwei Meinungen, und wer etwas anderes behauptet, lügt oder ist schon so verblendet, dass er den Bezug zur Realität verloren hat. Und während die einen sich in diesem Moment schon zum hysterischen Angriff auf den Autor dieser Zeilen rüsten, mögen die anderen sich vielleicht fragen, wie wir alle es zulassen konnten, dass das Aussprechen banaler Fakten dermaßen skandalisierungsfähig geworden ist. Denn es bricht einem wirklich das Herz, wie Bürgerinnen und Bürger im Glauben, eine bessere Zukunft zu schaffen, die wirtschaftlichen und sozialen Grundlagen ihrer Zukunft im wahrsten Sinne des Wortes über die Elbe jagen.
Besonders betroffen macht einen, dass das Narrativ der Hoffnungslosigkeit vor allem so viele junge Menschen erfasst hat. Diese sollten eigentlich zum Optimismus verdammt sein, denn sie müssen und dürfen es noch etwas länger auf diesem Planeten aushalten als die Älteren. Aber statt Lust aufs Leben herrscht bei vielen Furcht vor der Zukunft. Statt das Leben zu genießen, plagen sie sich mit diffusen bis sehr konkreten Ängsten – von einem verglühenden Erdball oder überfluteten Städten. Sie berauben sich ihrer eigenen Lebensfreude und ihrer besten Jahre. Ich halte das für eine menschliche Tragödie. Denn man kann die Herausforderungen des Klimawandels anerkennen und ernst nehmen, ohne gleich in kompletter Hoffnungslosigkeit zu versinken.
Deutschland oder Hamburg kann das Weltklima nicht verändern, aber es kann sich auf Veränderungen vorbereiten. Das wird übrigens immer schlechter funktionieren, je mehr wir uns unserer wirtschaftlichen Grundlagen berauben. Und das machen wir leider derzeit massiv. Der Rücktritt des Gesamtmetall-Chefs Wolf ist ein nie dagewesener Hilfeschrei über die industriellen Grundlagen unserer Republik. Unsere Produktion schrumpft, und die technologiefeindlichen Tiraden des Kulturstaatsministers auf der Frankfurter Buchmesse lassen auch immer weniger Hoffnung zu, dass sich bei so einem politischen Klima in der KI-Revolution auch für unser Land neue Geschäftsmodelle ergeben. Das sind die Fragen, mit denen man sich beschäftigen sollte, wenn man einen Entscheid über die Zukunft abhalten will. Stattdessen verschärfen wir unsere wirtschaftlichen Probleme ohne Not, aber dafür mit Ansage, und tragen so zur realen Unsicherheit – wirtschaftlich und sozial – bei. Es ist eine selbsterfüllende Prophezeiung.
Der Hamburger Entscheid zeigt, dass im Kampf um die Deutungshoheit das Rationale verliert. Was damit zusammenhängen kann, dass rationale Menschen sich nicht mit der gleichen Verve an Debatten beteiligen wie von Emotionen getriebene Menschen. Wenn in einer Kommune etwa jemand anstrebt, die lokale Klimaneutralität immer weiter vorzuziehen, dann wird wohl kaum jemand entgegentreten und sagen: Entschuldigung, aber ihr habt einen Knall. Dabei wäre es notwendig, dass irrationale und gefährliche Entscheidungen offener und ehrlicher angesprochen werden. Oder irgendwann glauben alle Mitbürgerinnen und Mitbürger, unsere Selbstkasteiung sei der Schlüssel zur Rettung der Welt.
Ich jedenfalls glaube fest daran, dass wir alle Chancen auf eine gute Zukunft haben – für uns, unsere Kinder und die, die danach kommen. Aber auf eine gute Zukunft zu hoffen, ist das eine, für sie zu kämpfen, das andere. Und Teil dieses Kampfes muss es sein, den Gegnern dieser hoffnungsfrohen Zukunft, den Predigern des Weltuntergangs und den ehrlich um die Zukunft unseres Planeten besorgten Menschen mit Entschlossenheit klarzumachen, dass deutsche oder regionale Alleingänge unsere Zukunftsfähigkeit massiv beeinträchtigen und eine reale Gefahr darstellen. Der Hamburger Entscheid muss ein Weckruf werden – für alle, die an die Kraft des gesunden Menschenverstands glauben. Und an eine Bundesrepublik Deutschland, die auch noch im Jahr 2040 genug wirtschaftliche und gesellschaftliche Ressourcen hat, sich auf das, was auch immer kommen mag, vorzubereiten.
—–
Quelle: Freie Demokratische Partei am 18. Oktober 2025
Foto: Wolfgang Kubicki © Laurence Chaperon