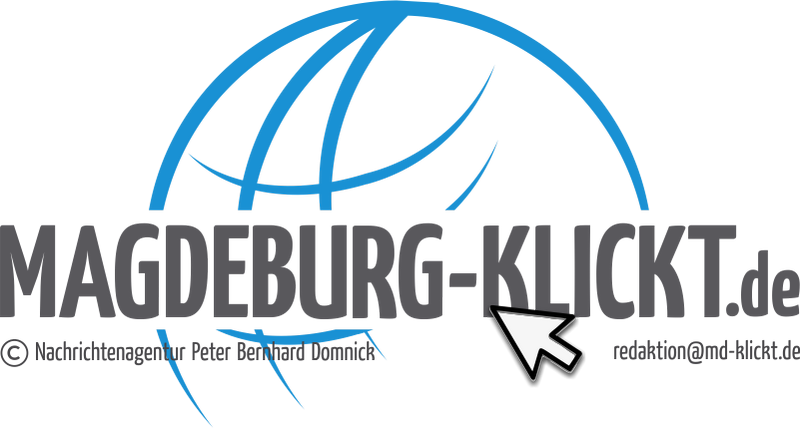Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses des Europäischen Parlaments und Leiterin der FDP-Delegation im Europäischen Parlament, Dr. Marie-Agnes Strack-Zimmermann MdEP, gab „WELT online“ folgendes Interview. Die Fragen stellte Thorsten Jungholt.
Frage: Der Bundeskanzler hat die Ambition, die Bundeswehr zur stärksten konventionellen Armee in der EU auszubauen. Wie wird dieses Ziel in Europa gesehen – mit Zustimmung oder mit Sorge?
Strack-Zimmermann: Grundsätzlich wird in Europa goutiert, dass Deutschland mehr Geld in die Hand nimmt. Die Nachbarn beobachten auch mit großem Interesse, dass hierzulande endlich eine sicherheitspolitische Debatte stattfindet – über Dienstpflicht, über Freiwilligkeit, über den Zustand der Bundeswehr. Aber unsere Partner warten ab, ob den Ankündigungen auch Taten folgen. Die Erwartung ist klar: Deutschland soll führen. Das ist als Kompliment gemeint – nur wird es noch nicht erfüllt.
Frage: Gibt es in der EU eine einheitliche Wahrnehmung der Bedrohung durch Russland?
Strack-Zimmermann: Die große Mehrheit sieht die Bedrohung klar. Unterschiede verlaufen entlang parteipolitischer Linien: Rechte Kräfte halten das alles für übertrieben, auch Teile der Linken sehen keinen Handlungsbedarf. Aber das politische Zentrum, Kommission, Parlament – die nehmen die Gefahr sehr ernst. Wir haben mittlerweile einen EU-Kommissar für Verteidigung und Weltraum, eine Vizepräsidentin für Cyberspace und Grenzschutz, und eine Hohe Beauftragte für Außenpolitik. Alle drei kommen aus Ländern mit russischer Grenze. Das Thema ist also in der Mitte Europas angekommen. Aber: Die Sicherheit liegt immer noch in nationaler Hand. Kooperation entsteht nur, wenn die Mitgliedstaaten Vertrauen in Brüssel setzen und die in der EU geschaffenen Programme zur militärischen Ertüchtigung auch mit Leben erfüllen.
Frage: Ist Europa aktuell ausreichend aufgestellt, um Russland militärisch abzuschrecken?
Strack-Zimmermann: Jedenfalls nimmt Russland sehr wohl wahr, dass sich hier etwas verändert. Allein die Diskussion über gemeinsame Verteidigung wirkt abschreckend. Aber die EU ist keine Nato 2.0. Die Allianz bleibt das Rückgrat unserer Verteidigung – und sie ist durch Finnland und Schweden noch stärker geworden. Beide sind ein echter Gewinn, Schweden ist ein Vollsortimenter in Sachen Verteidigung. Natürlich versucht Moskau weiterhin, Einfluss zu nehmen – auf Ungarn, auf die Slowakei, auf Politikertypen, die anfälliger sind, der Stimme Putins zu folgen. Das zeigt, wie sehr Russland auf die innere Schwäche Europas hofft.
Frage: In Europa wird seit Jahren eine bessere Koordinierung der Rüstungspolitik gefordert. Passiert das endlich – oder baut jedes Land weiterhin seine eigenen Champions auf?
Strack-Zimmermann: Die Gefahr besteht, keine Frage. In Deutschland etwa geben wir jetzt viel Geld aus, ohne unsere Beschaffungsstrukturen zu reformieren. Wenn wir das nicht gleichzeitig angehen, verpufft der Effekt. Es darf nicht darum gehen, nationale Interessen zu bedienen, sondern die besten Angebote und die beste Technik zum Zuge kommen zu lassen. Genau das soll unter anderem das „European Defense Industry Programme“ leisten – gemeinsame Beschaffung unter Aufsicht der Europäischen Verteidigungsagentur, die übrigens von einem Deutschen geführt wird. Aber das funktioniert nur mit liebevollem Druck und klarer Kontrolle.
Frage: Das deutsch-französische Rüstungsprojekt FCAS, das Kampfflugzeug der Zukunft, wackelt. Wird es scheitern – und Frankreich womöglich durch Schweden ersetzt?
Strack-Zimmermann: Das ist in erster Linie ein Industrieprojekt, aber natürlich schauen wir als Politiker genau hin, weil es um viel staatliches Geld geht. Frankreichs Industrie beansprucht eine sehr dominante Führungsrolle, alle anderen sollen andocken. Das funktioniert so nicht auf Dauer. Sollte FCAS scheitern, gibt es Alternativen: eine Kooperation mit Schweden, Großbritannien und Spanien. Das Grundkonzept war richtig, aber solche Projekte können nur auf Augenhöhe gelingen. Frankreichs Präsident Macron macht Druck, verliert aber spürbar an Einfluss, weil sich Teile der Industrie dort politisch nach rechts zu Le Pen orientieren. Das ist gefährlich.
Frage: Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) hat den Diplomaten Jens Plötner als Staatssekretär mit der deutschen Aufrüstung betraut. Eine gute Wahl?
Strack-Zimmermann: Um undiplomatisch zu antworten: Ich halte das für einen Fehler. Jens Plötner gehört zu denjenigen, die in der Vergangenheit Panzerlieferungen an die Ukraine gebremst und die Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern verhindert haben. Jetzt ausgerechnet ihn zum Chef der Beschaffung zu machen, ist, als würde man den Bock zum Gärtner befördern. Wenn jemand jahrzehntelang für eine Russland-Politik stand, die beschwichtigte und verharmloste, dann ist er kaum der Richtige, um unsere Aufrüstung zu leiten, um uns genau vor dem Russland zu schützen. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass Boris Pistorius das wirklich begeistert.
Frage: Union und SPD haben sich auf einen neuen, freiwilligen Wehrdienst geeinigt – mit Option auf Wiedereinführung der Pflicht. Können Sie als Liberale mit diesem Kurs leben?
Strack-Zimmermann: Dieser Plan wurde bereits zur Zeit der Ampel vorbereitet und setzt zunächst auf Freiwilligkeit. Wer Deutschland verteidigen soll, muss das aus Überzeugung tun, weniger aus Zwang. Bei rund 400.000 jungen Männern pro Jahrgang, abzüglich derer ohne deutschen Pass oder mit gesundheitlichen Einschränkungen, bleiben etwa 250.000 Musterungsfähige. Wenn wir zehn bis 15 Prozent davon gewinnen, ist der jährliche Aufwuchs erreichbar. Das Interesse ist mittlerweile groß – aber die Strukturen entsetzlich langsam bis gar nicht vorhanden. Wir müssen schneller werden, ohne neue Bürokratie. Ich halte es auch verfassungsrechtlich für möglich, die Frauen in die Musterung einzubeziehen. Es gibt keinen Grund, auf die Hälfte der Bevölkerung zu verzichten. Dieser Fragebogen dagegen, der jetzt zunächst verschickt werden soll, ist überflüssig.
Frage: Warum das?
Strack-Zimmermann: Weil er das Verfahren unnötig verlängert. Stattdessen sollte es sofort die Musterung geben an den Schulen, Berufsschulen, Ausbildungsstätten. Junge Menschen müssen direkt angesprochen werden. Attraktivität entsteht nicht durch Papier, sondern durch klare Angebote: Stipendien, Zuschüsse, echte Perspektiven.
Frage: Die Regierung setzt auf mehr Sold und einen Zuschuss zum Führerschein.
Strack-Zimmermann: Das reicht aber nicht. Wir brauchen Anreize, die langfristig wirken. Zum Beispiel Stipendienprogramme oder – ein Vorschlag der FDP – Militärakademien nach internationalem Vorbild. Das Militärische sollte als Berufsfeld mit Mehrwert für die Gesellschaft verstanden werden.
Frage: Eine Militärakademie – was meinen Sie damit genau? Es gibt bereits zwei Universitäten der Bundeswehr.
Strack-Zimmermann: In vielen Ländern – den USA, Israel – gibt es Akademien, an denen junge Menschen studieren und gleichzeitig militärische Verantwortung übernehmen. Sie können dort einen Bachelor in Informatik, Ingenieurwesen oder Volkswirtschaft machen, ihre Kenntnisse in militärische Forschung einbringen und anschließend in zivilen Bereichen anwenden. Ohne militärische Forschung gäbe es kein GPS, kein Internet, auch keine Mikrowelle. Deutschland sollte in Menschen und Technologien investieren, nicht nur in Gerät. Wer sich verpflichtet, bekommt ein praxisorientiertes Studium und kann danach eigene Projekte gründen – etwa in Cybersicherheit, Drohnentechnik oder KI. So entsteht Innovation, die sowohl Verteidigung als auch Wirtschaft stärkt. Es geht um angewandte Forschung, um Technologie und volkswirtschaftlichen Mehrwert. Wir müssen das Militärische wieder positiv framen – als Teil wissenschaftlicher und gesellschaftlicher Entwicklung. Dazu gehört auch, dass deutsche Universitäten endlich die Zivilklausel überdenken. Wer Forschung komplett vom Militär trennt, bremst die technische Innovationskraft.
Frage: Ist Freiwilligkeit angesichts des Personalbedarfs wirklich ausreichend? Die Bundeswehr verfehlt schon ihre alte Zielmarke von 203.000 Soldaten deutlich, jetzt braucht es bis zu 270.000.
Strack-Zimmermann: Im Moment halte ich Freiwilligkeit für den richtigen Weg. Deutschland hat ohnehin zu wenig junge Menschen für den Arbeitsmarkt – wir müssen sie in der Tat für die Bundeswehr gewinnen. Aber richtig ist: Es reicht nicht, einfach mehr Menschen zu rekrutieren, wir müssen auch die Strukturen umbauen. Zu viele Soldaten verbringen zu viel Zeit in der Kaserne und der Verwaltung. Wir brauchen eine Bundeswehr, die beweglicher ist, vernetzter, sichtbarer in der Gesellschaft. Vielleicht sehen wir in einem Jahr, dass es nicht so funktioniert, wie dringend erforderlich. Dann werden wir alle – auch wir als Liberale – angesichts der akuten Bedrohung auch über andere Modelle reden müssen.
—–
Quelle: Freie Demokratische Partei am 23. November 2025
Foto: Marie-Agnes Strack-Zimmermann (c) FDP