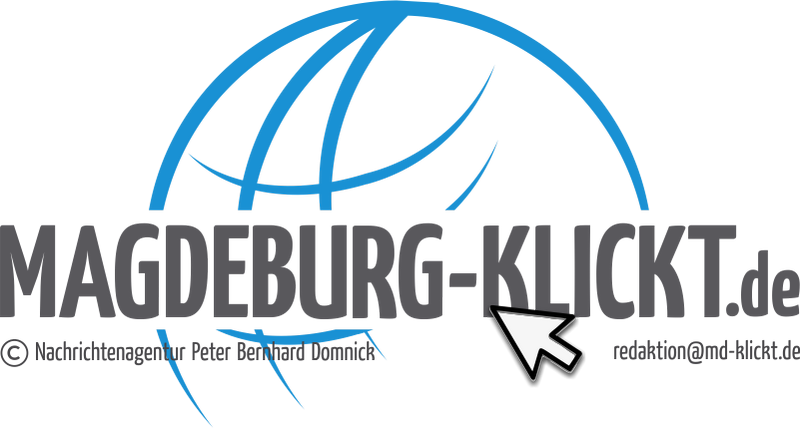Die Regulierung des Glücksspielmarktes in Deutschland befindet sich in einem tiefgreifenden Wandel und der ist auch in Magdeburg zu spüren. Seit dem Inkrafttreten des Glücksspielstaatsvertrags 2021 (GlüStV 2021) gilt erstmals ein einheitlicher rechtlicher Rahmen für Online-Angebote wie virtuelle Automatenspiele, Online-Poker und Sportwetten.
Mit der Gemeinsamen Glücksspielbehörde der Länder (GGL) ist zudem eine zentrale Aufsicht geschaffen worden, die seit 2023 bundesweit für Erlaubniserteilung, Kontrolle und Sanktionierung zuständig ist.
Nun hat die Innenministerkonferenz im Juli 2025 den Zweiten Staatsvertrag zur Änderung des GlüStV beschlossen, um vor der Gesamtevaluierung erste Anpassungen vorzunehmen.
Strengere Regulierung und zentrale Kontrolle
Vor dieser Kulisse rücken erneut Fragen nach den wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und rechtlichen Folgen in den Fokus, insbesondere da aktuell wöchentlich neue Casinos auf dem Markt erscheinen.
Denn die Schaffung der GGL war ein entscheidender Schritt, um den zuvor stark fragmentierten Glücksspielmarkt besser zu überwachen.
Die Behörde verfügt über moderne Kontrollinstrumente, etwa das automatisierte Limit- und Sperrsystem LUGAS, mit dem Einzahlungen und Spielverhalten anbieterübergreifend überwacht werden, sowie das Sperrsystem OASIS, das Spieler mit problematischem Verhalten von allen legalen Angeboten ausschließt.
Ziel ist es, illegale Anbieter zurückzudrängen und legale Angebote unter strengeren Auflagen sicherer und transparenter zu machen.
Die nun beschlossenen Anpassungen am Staatsvertrag zielen darauf ab, einzelne Regulierungsbereiche nachzuschärfen. Diskutiert werden unter anderem effizientere Kontrollmöglichkeiten im Online-Bereich sowie eine klarere Abgrenzung zwischen legalen und illegalen Angeboten.
Damit setzt die Politik ein Signal, dass die Reform von 2021 nicht als abgeschlossen betrachtet wird, sondern ein dynamischer Prozess bleibt.
Wirtschaftliche Auswirkungen
Die ökonomische Bedeutung des Glücksspielmarktes ist erheblich. 2023 belief sich der Umsatz im legalen deutschen Glücksspielmarkt auf rund 63,47 Milliarden Euro, ein Plus von 19,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr.
Dieses Wachstum verdeutlicht, wie schnell sich der regulierte Markt etabliert, nachdem zuvor viele Spieler im Graubereich aktiv waren.
Auch die Steuerstatistik zeigt deutliche Bewegungen. Die gesamten Glücksspielsteuern beliefen sich 2023 auf rund 2,48 Milliarden Euro. Innerhalb dieser Summe verzeichneten die Sportwetten einen Rückgang von 5,2 Prozent auf 409 Millionen Euro.
Noch stärker sanken die Einnahmen aus virtuellen Automatenspielen, die um 38,5 Prozent auf 264 Millionen Euro einbrachen. Online-Poker verlor 7,5 Prozent und kam auf 30 Millionen Euro. Diese Zahlen zeigen, dass die Marktsegmente unterschiedlich auf Regulierung und Konsumverhalten reagieren.
Für den Staat ergibt sich dennoch ein beträchtliches Steueraufkommen, das künftig zweckgebunden in soziale Projekte und den Ausbau digitaler Infrastruktur fließen soll.
Neue Marktchancen und Anpassungsdruck
Für neue Anbieter eröffnet der regulierte Markt Chancen, wenn sie bereit sind, hohe Anforderungen an Sicherheit, Spielerschutz und Transparenz zu erfüllen. Die GGL veröffentlicht regelmäßig eine Whitelist mit erlaubten Angeboten, die fortlaufend erweitert wird.
Bestehende Anbieter wiederum stehen unter erheblichem Anpassungsdruck. Um ihre Position zu sichern, müssen sie in technische Infrastruktur, Compliance-Abteilungen und Monitoring-Systeme investieren.
Langfristig könnte sich dies lohnen, denn die Regulierung schafft stabile Rahmenbedingungen und steigert das Vertrauen der Spieler. Wer jedoch am bisherigen Geschäftsmodell festhält, läuft Gefahr, seine Lizenz zu verlieren oder aus dem Markt verdrängt zu werden.
Spielerschutz als zentrales Anliegen
Ein Hauptziel des Glücksspielstaatsvertrags ist der Schutz der Spieler. Mit den bundesweiten Einzahlungslimits von monatlich 1.000 Euro, den zentralen Sperrsystemen und der Auswertung von Spielverhalten sollen riskante Muster frühzeitig erkannt werden.
Ergänzend verpflichten die Behörden die Anbieter zu Aufklärungs- und Beratungsangeboten, um problematischem Verhalten vorzubeugen.
Die gesellschaftliche Dimension zeigt sich in den Folgekosten von Spielsucht. Studien der Forschungsstelle Glücksspiel an der Universität Hohenheim beziffern die jährlichen Sozialkosten pathologischen Spielens in Deutschland auf 300 bis 600 Millionen Euro.
Demgegenüber stehen Einnahmen aus Glücksspielgeräten von bis zu 1,37 Milliarden Euro jährlich. Diese Gegenüberstellung macht deutlich, dass wirksamer Spielerschutz nicht nur individuelle Schicksale beeinflusst, sondern auch ökonomische Entlastungen für die Gesellschaft bedeutet.
Die Reform des Glücksspielstaatsvertrags und die Arbeit der GGL markieren einen Wendepunkt für den deutschen Glücksspielmarkt. Während Anbieter mit strengeren Anforderungen und Investitionen konfrontiert sind, profitiert der Staat von höheren Steuereinnahmen und die Spieler von besserem Schutz.
Die Entwicklung des Jahres 2023 zeigt, dass der legale Markt wächst, die einzelnen Segmente sich aber unterschiedlich entwickeln.
Die nun eingeleiteten Nachjustierungen im Jahr 2025 unterstreichen, dass Regulierung ein fortlaufender Prozess bleibt. Entscheidend wird sein, ob es gelingt, das richtige Gleichgewicht zwischen Marktöffnung, Steuereinnahmen und gesellschaftlicher Verantwortung zu finden.
Die kommenden Jahre werden sowohl in Magdeburg als auch darüber hinaus zeigen, ob der deutsche Weg im Glücksspielrecht Modellcharakter entwickelt, oder ob weitere Korrekturen notwendig sind.
Text/Symbolfoto: Bazoom Group