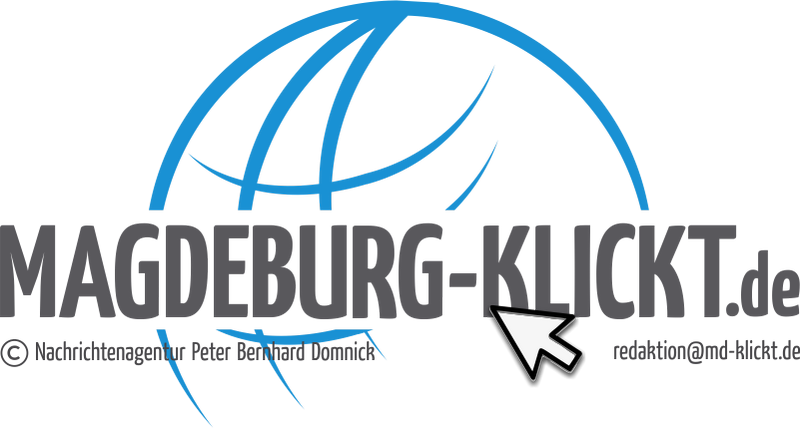Magdeburg. In den 2000er Jahren wurde bei Grabungen im Inneren des Magdeburger Doms ein kleiner goldener Löwenkopf gefunden, dessen Entstehungszeit auf das 12. Jahrhundert datiert wird. Sein Fundort in einem beräumten Grab im Mittelschiff des Doms sowie seine Beschaffenheit lassen darauf schließen, dass es einst die Krümme eines Bischofsstabs zierte. Dieses bedeutende Objekt, das sinnbildlich für die damalige Macht und Bedeutung des Erzbistums Magdeburg steht, wird ab sofort in einer umfassend überarbeiteten Präsentation im Dommuseum Ottonianum Magdeburg gezeigt.
Das filigrane Objekt, das im Original nur etwa drei Zentimeter misst, ist trotz seiner geringen Größe überaus plastisch und ausdrucksstark gearbeitet. Das Material, der Fundort und die Proportionen des Löwenköpfchens deuten darauf hin, dass es einst als Zeichen bischöflicher Macht und Würde diente. Dr. Gabriele Köster, Direktorin der Magdeburger Museen, sagte heute anlässlich der Neu-Präsentation: „Vor wenigen Tagen jährte sich der Geburtstag Kaiser Ottos des Großen zum 1.113 Mal. So freuen wir uns ganz besonders, dass wir ab heute in einer völlig neuen Form das goldene Löwenköpfchen hier im Dommuseum ausstellen können. Die Bedeutung des von Kaiser Otto I. begründeten Erzbistums Magdeburg wird in diesem besonderen Objekt versinnbildlicht.“ Die Kuratorin der Dauerausstellung im Dommuseum Ottonianum Magdeburg, Dr. Ulrike Theisen, ergänzte: „Das Löwenköpfchen wird ab sofort in einer Einzelvitrine mit modernster Lichttechnik und zurückgenommener Präsentationshilfe gezeigt, diese Inszenierung betont seine Einzigartigkeit im Spektrum der Domfunde. Zusätzlich illustrieren wir mit einer lebensgroßen Grafik eines Erzbischofs, wie das Objekt seinerzeit als Ausstattungselement des Bischofsstabs gewirkt haben könnte.“
Die genannten Grabungen wurden durch das Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt in Kooperation mit der Kulturstiftung Sachsen-Anhalt (damals noch Stiftung Dome und Schlösser in Sachsen-Anhalt) und der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg mit Unterstützung der Landeshauptstadt Magdeburg durchgeführt. Als Mitglied des Fördervereins des Dommuseums ging der damalige Ausgräber Rainer Kuhn heute auch auf die Umstände seiner damaligen Arbeit ein: „Als unser Grabungsteam vor 16 Jahren das kleine Objekt in dem ansonsten völlig beräumten Grab im Dom fand, war mir der archäologische Wert des Fundes schnell klar. Die Ausrichtung des Grabes und seine Lage in der Schichtenabfolge des Doms belegten eindeutig eine Datierung vor dem großen Dombrand vom Karfreitag 1207. Dazu handelt es sich um eines der ganz wenigen Objekte aus Gold aus der Domgrabung 2006-2010.“ Ebenfalls als Mitglied des Fördervereins und als maßgeblicher finanzieller Förderer der Neu-Präsentation ergänzte Ulrich Schneider: „Das Löwenköpfchen zeigt nunmehr sein Potential als Aushängeschild für das Museum, und das befriedigt mich und alle weiteren Unterstützer.“
Die neu gestaltete Präsentation des Löwenköpfchen kann zu den Öffnungszeiten des Dommuseums immer dienstags bis sonntags von 10 bis 17 Uhr besichtigt werden. Der reguläre Eintritt beträgt 7,50 Euro, ermäßigt 5 Euro, Kinder und Jugendlich bis 17 Jahre haben freien Eintritt.
Informationen zum Dommuseum Ottonianum Magdeburg
Das Dommuseum Ottonianum Magdeburg ist ein Gemeinschaftsprojekt des Landesamtes für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt, der Kulturstiftung Sachsen-Anhalt und der Landeshauptstadt Magdeburg. Auf etwa 650 Quadratmetern Ausstellungsfläche in den Räumen der ehemaligen Staatsbank am Domplatz 15 informiert es in seiner Dauerausstellung zu Kaiser Otto dem Großen, dem Erzbistum Magdeburg sowie zu den Bauten rund um den Magdeburger Dom und würdigt damit die bedeutende Rolle Magdeburgs als eines religiösen, herrschaftlichen und politischen Zentrums des römisch-deutschen Kaiserreiches von der Zeit Ottos des Großen bis zum Ausgang des Mittelalters. Es wurde am 4. November 2018 eröffnet.
Foto: Ausstellungsobjekt goldenes Löwenköpfchen (Seitansicht) (Copyright: Kulturhistorisches Museum Magdeburg, Charlen Christoph)